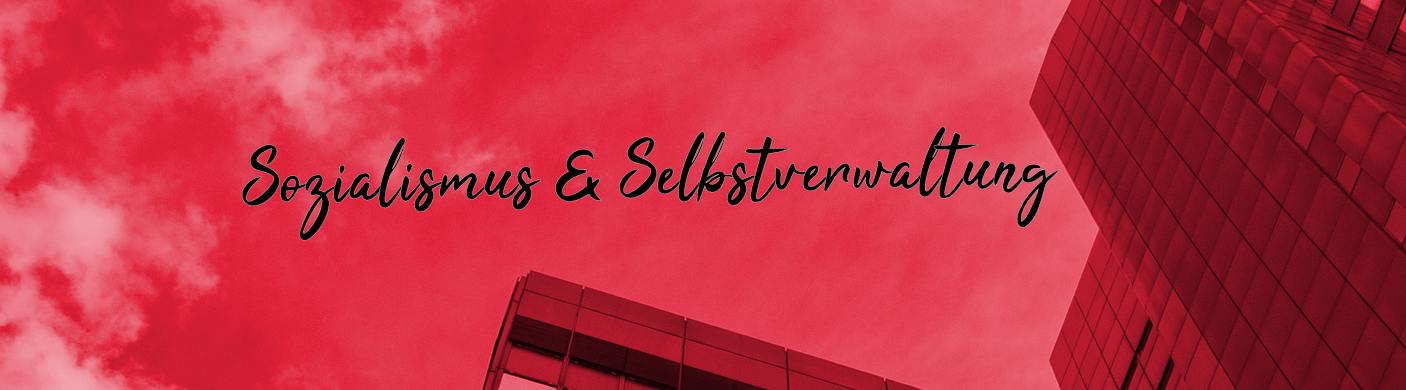Der Text ist aus unserer ersten gedruckten Zeitung von 2022. Die Preise haben sich seither natürlich verändert, das grundlegende Prinzip ist aber gleich geblieben. Darum lohnt es sich auch heute noch sich mit den Hintergründen von unseren Strompreisen zu beschäftigen.
Seit 1998 ist die durchschnittliche monatliche Stromrechnung für einen Haushalt in Deutschland um 112% gestiegen. Zum Vergleich: 1998 kostete eine Kilowattstunde im Schnitt 17,11 Cent, 1998 waren es bereits 29,47 Cent und im Frühling 2022 dann 35 Cent. Die konstante Teuerung der Strompreise ist keine direkte Folge des Krieges, sie ist durch einen politischen Prozess forciert worden – in Krisenzeiten wird dies nur besonders sichtbar.
Es begann 1998 mit der Reform des Energiewirtschaftsgesetz. Ziel war dabei den Strommarkt zu liberalisieren und die regional begrenzten Energiemonopole abzuschaffen. Die Unternehmen, die bisher Produktion und Verkauf unter einem Dach organisierten, mussten nun für jeden Bereich eigene Gesellschaften gründen und konnten nicht mehr als alleinige Versorger in der Region auftreten – so konnte man dann auch in den frühen 2000er Jahren erstmals den Stromanbieter wechseln.
Liberalisierung gegen Monopole
Im Zuge dieser „Liberalisierung“ wurden alle Stromproduzenten gezwungen ihren Strom an der Börse zu verkaufen. Dabei richtet sich der Verkaufspreis an der Börse, an den sich alle Anbieter halten müssen, allerdings nicht nach dem günstigsten Anbieter, sondern nach dem Teuersten. Durch die Bezuschussung erneuerbarer Energien (durch die EEG-Umlage) und eine Abnahmegarantie für diese, sollte ein Wettbewerbsnachteil dieses Sektors ausgeglichen werden und zudem der Strompreis an der Börse gedrückt werden, denn: die teuren Anbieter kommen überhaupt nur zum Zug, wenn die Günstigeren den Bedarf nicht bereits gedeckt haben. Sprich, wenn Ökostrom, Atomstrom und Kohle (die alle günstig produzieren) den Strombedarf abdecken, können die teuren Anbieter (Strom aus Gas) ihre Ware gar nicht mehr an der Börse anbieten, somit gäbe es einen günstigen Preis.
Die Realität sieht allerdings so aus, dass der Markt von erneuerbaren Energien politisch sabotiert wird (Förderungen laufen aus, bürokratische Hürden erschweren den Aufbau und Inbetriebnahme etc.) und der Strompreis somit konsequent an der teuerst möglichen Stromproduktion die wir haben bestimmt wird und vor allem die Gewinne von Konzernen in die Höhe getrieben werden. Das führt dann zu absurden Szenarien wie dem, dass die SWB in Bremen Strom zum Marktpreis von vor zehn Jahren produziert, eine ausgelagerte Gesellschaft der SWB den Strom zur Versorgung der Kunden an der Börse für die viel höheren Preise zurückkaufen muss und entsprechend teuer an die Verbraucherinnen weitergibt. Gewinner ist die SWB und angeschmiert alle, die hofften lokal günstig erzeugten Strom beziehen zu können.
Scheitern des Marktes
Offenkundig wird hier auch, wie wenig das System des freien Markts funktioniert. Statt einer Konkurrenz, die Preise nach unten drücken würde, – wie es uns von der Politik verkauft wurde – ist ein System entstanden, bei dem die Preise systematisch und von der Politik befeuert, nach oben getrieben werden.
Hier zeigt sich auch wieder einmal ein völlig falsches Verständnis von Monopol und Liberalismus und vor allem wie mit den Folgen umzugehen ist. Während es pragmatisch und einfach ist, wenn regional Ansässige Stromerzeuger die umliegenden Städte, Haushalte, Betriebe direkt mit Strom versorgen, ohne dass die Börse als Zwischenhandelsplatz eingeschaltet wird, sollte dieses „Monopol“ gebrochen werden, um einen „freien Markt“ zu schaffen. Real ist dieser freie Markt aber ein Zusammenschluss von Unternehmen, die deutschlandweite Preissteigerungen durchgesetzt haben und weiter durchsetzen. Getauscht wurde das pragmatische Monopol gegen das Oligopol (einige Wenige die den Markt beherrschen), welches nur zur Erhöhung der Gewinne existiert. So steigen die Strompreise seit über 20 Jahren kontinuierlich. Und verkauft wurde uns das Ganze als Fortschritt.
Re-Kommunalisierung
Das Energiewirtschaftsgesetz muss dahingehend reformiert werden, dass die Produzenten den Strom nicht mehr an der Börse verkaufen dürfen (die Börse also aufgelöst wird), sondern direkt an die Verbraucher zu den Produktionskosten abgeben – alles auf einer regional begrenzten Ebene. Das erzeugt natürlich regionale Unterschiede, weil in manchen Gegenden günstig und in anderen weniger günstig Strom produziert wird. Hier kann politisch gegengesteuert werden indem man 1. den Verkaufspreis an den günstigst produzierten Strompreis bindet und dies ggf. subventioniert, 2. die erneuerbaren Energien massiv ausbaut und fördert.
Gerade Solarenergie kann problemlos und ohne gesellschaftliche Auseinandersetzungen wie bei der Windkraft weiter ausgebaut werden, einzig: die Menschen brauchen das Geld um diese anzuschaffen. Hier müsste Politik auch ansetzen.
Perspektivisch würde es gelten, die lokalen Energieproduzenten unter lokale demokratische Kontrolle zu stellen, Bedürfnisse der Region zu erfassen, zu bedienen und mögliche Überschüsse an Regionen solidarisch abzugeben, die eine schlechtere Versorgungslage haben. Es kann nicht überall ein Kraftwerk stehen, das ist auch nicht nötig und in Zukunft sollten es eigentlich noch viel weniger werden. Aber bis der Weg zu einer wirklichen Energiewende abgeschlossen ist, wäre eine demokratisch-lokale Verwaltung der Stromproduktion und -abgabe dem Börsenmodell vorzuziehen. Außerdem gelingt eine grüne Wende mit Sicherheit schneller, wenn ihr nicht die Profitinteressen von Konzernen im Weg stehen.